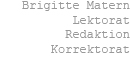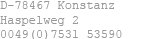Als Kaliningrad noch Königsberg hieß
Wehmut oder Empörung ergreift die ehemaligen Flüchtlinge aus Ostpreußen, wenn sie in ihre alte Heimat reisen. Diese hat sich in den fünfzig Jahren seit der Flucht doch sehr verändert.
"Was machen Sie hier?" fragt die Russin, nachdem sie mir den Weg zur orthodoxen Kirche gezeigt hatte; sie fragt es freundlich, aber bestimmt: "Sonst kommen doch nur ältere Leute her. Was wollen jetzt die Jungen?" Die Menschen hier, erklärt sie, hätten Angst, dass die Deutschen wiederkämen. Nein, sage ich, ein bisschen auch mich selbst beruhigend, "die kommen ganz bestimmt nicht wieder. Wer hier aufgewachsen ist, will nur noch einmal die Stätten der Kindheit aufsuchen." – Und wir Jungen? – Wir schauten nur, wo unsere Eltern herkommen. "Tolko otdychat?" fragt die Russin, noch immer etwas skeptisch. "Ja", bestätige ich, "wir machen hier nur Ferien."
In Swetlogorsk hat man schon immer Ferien gemacht, auch zu jenen Zeiten, als der Ort noch Rauschen hieß und zu der deutschen Provinz Ostpreußen gehörte. Rauschen mit seinem langen Sandstrand und der hohen Steilküste war einer der schönsten Kurorte an der Ostsee und ein beliebtes Ausflugsziel vor allem für die Menschen aus dem nahegelegenen Königsberg. Viel ist geschehen seither. Der Überfall Hitlers auf die Sowjetunion, die Besetzung Ostpreußens durch die Rote Armee und schließlich der Zusammenbruch der UdSSR. Zwar strömen die Menschen sommers noch immer hierher, für einen Tage, ein paar Wochen, um sich vom Alltag zu erholen und die prächtigen Sonnenuntergänge zu bestaunen, doch es sind nicht mehr ganz so viele, und sie kommen nicht aus Königsberg, denn die ehemalige Hauptstadt Ostpreußens heißt heute Kaliningrad.
Swetlogorsk ist eigentlich ein Wald. Im Schatten hoch gewachsener Birken und Kiefern stehen Villen – blau, grün oder ocker der teilweise verblasste Anstrich, dazu viel braunes Holzwerk; die meisten sind noch aus der Vorkriegszeit, arg oder charmant heruntergekommen die einen, frisch renoviert die anderen. Die neueren Erhohlungsheime daneben im schmucklos-funktionalen Sowjetstil tun dem brüchigen Charme des Ortes nur wenig Abbruch, die einstige Schönheit des Städtchens lässt sich noch leicht erahnen. Und wer etwas auf sich hält – wie etwa die russische Politprominenz –, besitzt hier ein Ferienhaus.
Aus den Kiosken dem Bahnhof entlang schallen russische und italienische Schlager; gut gekleidete RussInnen mit herausgeputzten Kindern an der Hand promenieren durch die Straßen. An der Seite parken deutsche Wagen gehobener Mittelklasse mit russischem Nummernschild, gelegentlich ist auch ein Lada zu sehen. HändlerInnen bieten teure Importware feil, Bananen, Ananas, Melonen. Ein Bernsteinverkäufer hat Rohlinge, Ketten und Broschen unterschiedlichster Farbe und Form ausgelegt. Daneben, hinter behelfsmäßig gezimmerten Ständen, wird Gemüse aus dem eigenen Garten angeboten; weiter oben wartet ein gelber Biertank auf Kundschaft; aus dem Café-Garten an der Ecke, wo gerade das Feuer für die tägliche Schaschlik-Produktion entfacht wird, steigen Rauchschwaden. Und noch etwas weiter, rechts die Straße hinauf, im Stadtpark um eine weiße Brunnenfigur geschart, folgt eine deutsche Reisegruppen den Worten ihrer Reiseführerin, die über den ostpreußischen Bildhauer Brachert und seine Werke referiert. Das sind wir.
Endlich im Sperrbezirk
Lange hatten die Menschen aus dem nördlichen Ostpreußen warten müssen, bis sie sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit begeben konnten. Das heute zu Polen gehörende südliche Ostpreußen ist bereits seit den siebziger Jahren zugänglich – der legendäre Kniefall Willi Brandts vor den polnischen Opfern des Zweiten Weltkrieges und die anschließenden deutsch-polnischen Verträge hatten den Weg dazu geebnet. Der russische Teil jedoch, das 15.000 Quadratkilometer große Verwaltungsgebiet Kaliningrad, blieb als streng bewachter militärischer Sperrbezirk verschlossen. Erst 1991, nach der Unterzeichnung der Vier-plus-zwei-Verträge, mit denen Deutschland die bestehenden Grenzen anerkannte, wurde die von Litauen und Polen umschlossene russische Exklave für den westlichen Besucherverkehr geöffnet. Seither haben die sogenannten HeimwehtouristInnen das Land zu Zehntausenden besucht.
Die meisten kamen in Gruppen, per Flugzeug, Bahn oder Bus, organisiert von eigens darauf spezialisierten deutschen "Ostreise"-Unternehmen. Wir sind vierundzwanzig an der Zahl und haben eine Woche Halbpension in Rauschen gebucht, mit Ausflügen zu Stätten ostpreußischer Kultur und Geschichte. Und natürlich mit dem obligatorischen freien Tag für eigene Erkundungen. Einige meiner ReisegefährtInnen (es sind hauptsächlich Frauen) sind Mitglieder der Ostpreußischen Landsmannschaft, der Interessenvertretung der ostpreußischen Heimatvertriebenen. Und die meisten sind über fünfundsechzig Jahre alt.
Sie sei bereits zum vierten Mal hier, hat mir eine Frau bei der Anreise im Zug erzählt. Doch diesmal sei sie nur wegen ihrer Freundin mitgekommen. Die habe ihren ersten Besuch nicht verkraftet, sei tränenüberströmt und halb besinnungslos über die Ruinen ihres Dorfes gestolpert und danach noch stundenlang nicht ansprechbar gewesen. Da habe sie und eine Freundin, die auch mit dabei sei, sie gezwungen, noch einmal hierherzufahren. Schließlich müsse sowieso jeder zweimal kommen: "Einmal, um die Vergangenheit zu suchen, das andere Mal, um die Wirklichkeit zu erkennen."
Auch eine andere Frau, mit knapp achtzig Jahren die älteste unserer kleinen Truppe, begann gleich zu erzählen. Sie hatte damals noch drei Jahre lang als Ärztin "unter den Russen" im Königsberger Infektionskrankenhaus arbeiten müssen. Dann, 1948, war auch sie, wie die restlichen verbliebenen Deutschen, außer Landes geschafft worden. Sie kennt sich aus hier, denn seit der Öffnung des Gebiets kommt sie jedes Jahr. Sie sucht ihre alte Arbeitsstelle auf und ihre Wohnstätte, dort sammelt sie Zweige und Gräser, die sie dann, in feuchte Tücher gehüllt, nach Hause bringt – für den Garten, die Fensterbank. Die Gräser erneuert sie jedes Jahr, schon allein deshalb muss sie immer wiederkommen. Mit den BewohnerInnen ihrer ehemaligen Wohnungen haben sie inzwischen Bekanntschaft geschlossen. Geschenke wurden überreicht, Tee serviert. Selbst die Zimmer durften sie besichtigen – "mit Ausnahme des Kellers", erzählt die eine, "der ist seit Kriegsende zugemauert."
Dass in unserer Gruppe beinahe alle zum zweiten Mal hier sind, macht die Atmosphäre entspannt. Die erwartungsvolle Angst vor dem ersten Wiedersehen mit der alten Heimat und die zwangsläufige Enttäuschung haben sie schon durchlitten, sie wissen, was von ihrem Haus, dem Hof, der Stadt noch übrig ist, und dass es das Land der so lange gehegten Sehnsucht nicht mehr gibt. Viel wird gelacht und gerne, gelegentlich auch gefeiert, schließlich ist man ja Ostpreuße. Doch die Haut ist noch dünn, und schnell einmal weicht die Gelassenheit bitterer Wehmut und Empörung. Das sind die Momente, in denen man sie gerne schütteln und sagen möchte: Nehmt euch zusammen, ihr seid hier zu Gast! Aber gerade das ist ihr Problem.
Was das ostpreußische Herz bewegt
Ich selbst weiß nicht, wie es aussah, das "schöne alte Ostpreußen". Ich kenne nur die Geschichten meines Vaters. Von seinem Opa Friedrich, den er so geliebt hatte, und auf dessen Hof er, das Beamtenkind, mit Hammer und anderem Werkzeug zu hantieren lernte. Von den Seen bei Preußisch Eylau, auf denen es sich im Winter, vom Wind vorwärtsgetrieben, so prächtig eislaufen ließ. Von dem Haus in der Kirchenstraße, das es nun nicht mehr gibt. Von der Nacht, in der Königsberg so bombadiert wurde, dass man es noch in vierzig Kilometern Entfernung sehen konnte. Und von jenem 30. Januar 1945, als er, beinahe fünfzehnjährig, losgeschickt wurde, um Opa zu holen: wie ihn ein deutscher Soldat umkehren hieß mit den Worten: Jungchen, lass man, den hat längst der Iwan, und wie ihm da auf dem Heimweg die Tränen zu Eis gefroren sind. Und natürlich die Geschichten von der Flucht, wie die vier Geschwister allein losziehen mussten, weil Landsberg, wo die Eltern warten wollten, bereits eingenommen war, wie sie also allein über das Frische Haff nach Pillau und weiter in den Westen gelangten, und wie sie dabei so sehr viel Glück gehabt haben. Das ist mein kleines Päckchen, mit dem ich hierhergefahren bin. Aber hier gelebt, es mit eigenen Augen gesehen, an der eigenen Haut erfahren, das habe ich nicht.
Galina, unsere georgische Reiseführerin, gibt sich alle Mühe mit der kleinen Gesellschaft. Sie ist schon seit sieben Jahren im Heimwehtourismusgeschäft, sie weiß, was das ostpreußische Herz bewegt und kennt auch die Klagen, die ständig wiederkehrenden, über den Schmutz im Land, die Armut und wie doch das Land so heruntergekommen sei. Während der Busfahrten liest sie Gedichte und Geschichten ostpreußischer HeimatschriftstellerInnen vor, gelegentlich sogar in ostpreußischem Platt. Und sie erzählt von den UkrainerInnen, RussInnen und WeißrussInnen, die, als alle Deutschen vertrieben waren, hierher umsiedeln mussten, weil deren Land nach dem Krieg vollkommen zerstört war. Sie sagt aber auch, dass die einfachen Leute für diesen Krieg nichts könnten, dass die Mächtigen die Schuldigen seien – hüben wie drüben. Damit ist man im Bus einverstanden.
Am Fenster fliegen derweil die Wiesen vorbei, die sich sanft die Hügel hinaufziehen, gelegentlich unterbrochen von einem großen, disteldurchsetzten Kornfeld, einem Kartoffelacker, einem Waldstück. Die Fahrt geht durch lange, oft von dichtem Baumwerk übertunnelte Alleen, schwarzweiße Kühe weiden vereinzelt am Wegrand, auch Ziegen und Schafe laufen frei herum. Und überall Störche, auf Hausdächern, zerfallenen Kirchtürmen, einbeinig im Gras. "Ostpreußen war ein schönes Land, und ist es noch heute" – Galina wiederholt es gerade zum dritten Mal. Ja, denk ich; doch andere sind darüber nicht so glücklich.
Heute hier zu leben sei schwer, sagt Galina. Die Wohnungsnot ist groß, zehntausende Soldaten mussten nach dem Abzug der russischen Truppen aus Ostdeutschland und dem Baltikum hier zusätzlich untergebracht werden. Der Zusammenbruch der Kolchosen und Staatsbetriebe hat wie überall in der ehemaligen Sowjetunion viele Arbeitslose hinterlassen. Ein Monatslohn beträgt oft nur 200 Mark, eine Rente vielleicht ein Zehntel davon. Ohne das Stückchen Land, das fast jedeR besitzt, käme auch hier niemand über die Runden. Am Wegrand sehen wir die Frauen mit ihren Eimern voll Gemüse auf den Bus warten. Einige verkaufen die Ernte des Tages gleich an der Straße, dazu noch Pilze aus den Wäldern und Beeren.
Der deutsche Traum vom deutschen Volk
Dann sind wir in Jasnaja Poljana, dem ehemaligen Trakehnen. Viel ist von dem einst weltberühmten Trakehnergestüt nicht übriggeblieben – ein paar baufällige Backsteinbauten und das einstige großherrschaftliche Stallmeisterhaus. Von den über tausend Pferden haben nur etwa zwei Dutzend die Flucht nach Westen überlebt. Erich Koch, der damalige Gauleiter Ostpreußens, hatte die Evakuierung der Pferde lange verhindert. "Falls die Russen vorübergehend vorstoßen sollten, können die Trakehner ja im Wettlauf mit den sowjetischen Panzern ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen!" soll er damals gesagt haben.
Die Pferde, die den Russen in die Hände fielen, wanderten 1948 alle in die Fleischfabrik: Der Trakehner, ein ausgeprochenes Militärpferd, galt ihnen als Inbegriff des deutschen Militarismus. Dann haben sie das Gestüt in ein Staatsgut für Rinderzucht und Milchwirtschaft umgewandelt. Vor sechs Jahren wurde es privatisiert; die Sowchoseangehörigen bekamen je zehn Hektar Land, doch die meisten gaben es wieder zurück, da es ohne Geld für Maschinen und Saatgut für sie wertlos blieb.
Ein paar hundert Russlanddeutsche leben heute in Jasnaja Poljana. Im ganzen Kaliningrader Gebiet sollen es etwa 50.000 sein. Sie kommen aus Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan oder Tadschikistan; ihre Vorfahren waren einst im 18. Jahrhundert von Zarin Katharina als SiedlerInnen an die Wolga und das Schwarze Meer gerufen worden. Nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion hatte Stalin diese dann als vermeintliche Kollaborateure in die mittelasiatischen Steppengebiete verbannt.
Ein kleiner Kreis untentwegt Heimattreuer unterstützt die Ansiedlung der Russlanddeutschen seit 1991 von Deutschland aus. Da ist zum Beispiel die private Hilfsorganisation "Deutsches Königsberg": Den Russlanddeutschen "gehört unser Herz, weil es unsere Menschen sind, weil wir uns hier den Traum von einem Volk erfüllen (...) den Traum von der großen Gemeinschaft, vom Zusammenhalten; den deutschen Traum vom deutschen Volk", schrieb der ehemalige Schirmherr der Organisation im Vorwort des Buches "Das letzte Dorf". Die Ergebnisse der Vier-plus-zwei-Gespräche, in denen die Bundesrepublik 1990 offiziell auf jedwede Gebietsansprüche verzichtete, "mögen als unabänderliche Zwänge der Gegenwartspolitik eingeschätzt werden. Als Ergebnis vielfacher Rechtsbeugung" seien die Grenzzusicherungen aber "völkerrechtlich ohne Belang". Man hofft nämlich noch immer auf die Vereinigung Deutschlands – 1989 war "lediglich eine Teilvereinigung West- und Mitteldeutschlands". Dietmar Munier, Autor des Buches und Initiator der Aktion, plädiert deshalb unumwunden für die Nutzung der "vielleicht unwiederbringlichen Chance, hier durch Ansiedlung möglichst vieler Russlanddeutscher Tatsachen zu schaffen". Seine Spendenaufrufe treffen in Deutschland auf einige Resonanz.
Eine ganze Neubausiedlung ist im ehemaligen Trakehnen für die Russlanddeutschen entstanden. Auch mit Traktoren, Werkzeug und Saatgut wird ihnen unter die Arme gegriffen. Da die junge Generation kein Deutsch mehr spricht, wurde ein "Schulverein zur Förderung der Russlanddeutschen in Ostpreußen" gegründet. Doch uns wird nur das alte Gemäuer und ein scheppernder Film über die Militärhengstzucht gezeigt.
Das ist schade, denn einerseits fördert es nicht gerade die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften, wenn die Russlanddeutschen plötzlich über Gerät verfügen, von dem die Russen nur träumen können. Andererseits soll es aber auch mit der Ansiedlung nicht so recht klappen. "Wir wollen weg, uns jefällt es nich' hier", hatten wir bereits auf der Fahrt hierher gehört. Für viele Russlanddeutsche, so heißt es, sei das Kaliningrader Gebiet nur eine Zwischenstation auf ihrem Weg in die Bundesrepublik. Wer aus den mittelasiatischen Staaten kommt, flieht meist nicht nur vor (wirklicher) Diskriminierung. Man versucht auch dem Chaos der nachsowjetischen Wirtschaft zu entkommen – und das ist hier genauso groß wie dort.
Unsere deutsche Reisebegleiterin, eine resolute Ostpreußin von 75 Jahren, hat, wie sie mir augenzwinkernd versichert, auch "ein gewisses Interesse, dass sich hier die Russlanddeutschen ansiedeln". Sie glaubt jedoch nicht daran, dass das Gebiet einmal wieder deutsch werden könnte: "Wenn ich mir unsere Leute in der Landsmannschaft so ansehe", meint sie ein bisschen resigniert, "dann weiß ich, dass das unrealistisch ist." Bis vor kurzem stand sie dem Berliner Landesverband der Landsmannschaft vor (und wer sie sieht, dem ist klar: mit eisernem Zepter); dabei hat sie wohl die Erfahrung gemacht, dass den einfachen Mitgliedern die gemeinsamen Feiern wichtiger sind als Politik. "Wir hatten auch so einen Scharfmacher als Vorsitzenden", hat mir zuvor eine andere Frau erzählt, doch das habe nur Unruhe gegeben, "wir sind froh, dass er weg ist."
Die Front war lange fern
Abends erzählen die Frauen vom Damals, von den glücklichen Zeiten, als sie jung waren und der Krieg noch fern. Wie herrlich es beim Arbeitsdienst war, der die jungen Leute ein halbes Jahr von Zuhause fortbrachte, zum Ernteeinsatz, irgendwohin aufs Land. Und wie schwierig es war, einen Mann auch nur zum Tanzen zu finden, da ja alle im Krieg waren ("da musste eine schon was hermachen"). Und wie ihnen dann auch, die Front war noch immer fern, das Tanzen verboten worden war.
Vom Kriegsgeschehen war im nördlichen Ostpreußen lange Zeit kaum etwas zu spüren gewesen. Das Leben ging seinen gemächlichen Gang, zu essen gab es immer noch genug. Nur auf den Feldern arbeiteten längst Kriegsgefangene aus England, Belgien, Frankreich, Polen und Russland. Im August 1944 erst wurde die reiche Provinz aus ihrer Ruhe gerissen, als die Royal Airforce Königsberg, die alte Kantstadt, in Schutt und Asche legte. Die ersten Flüchtlingstrecks machten sich auf den langen Weg "ins Reich". Aber viele blieben, im Vertrauen auf Hitler und seine Wunderwaffe, und wegen Gauleiter Erich Koch ("das Schwein", wie mein Vater ihn nennt), der allen auch dann noch verboten hatte, die Dörfer zu verlassen, als die sowjetischen Truppen bereits vor der Tür standen – um sich selbst eines Nachts heimlich aus dem Staub zu machen.
Was darauf folgte, was sie an Furchtbarem gesehen und erlebt haben, darüber reden die Mitglieder der Reisegruppe wenig. Nur eine erzählt verbittert, dass sie damals ihr drei Monate altes Kind verhungert im Schnee zurücklassen musste.
"Sie haben alles kaputtgemacht
Immer wieder aber verschafft sich die Fassungslosigkeit Luft: "Was haben die aus unserem Land gemacht! – Der Boden war gut, man hätte doch nur anpacken müssen." Viel ist in der Tat nicht bewirtschaftet. Die einst mühsam angelegten Entwässerungsgräben sind zerstört, die Wiesen sauer geworden. Die Häuser der Vorkriegszeit, von denen es noch viele gibt, sind meist stark vernachlässigt, einige stehen als Ruinen inmitten von Siedlungen, abgebrannt, ausgeweidet. Um die Vorgärten hängen windschiefe Zäune. Das Trinkwasser muss abgekocht werden, die Abwässer der Städte fließen ungeklärt in Flüsse, Seen, Haff und Ostsee.
Ostpreußen war ein blühendes Agrarland, beinahe zwei Drittel des Landes standen unter dem Pflug, und die Weiden ernährten große Viehherden. Nun produziert die einstige "Kornkammer des Reiches" nur noch wenig. Beinahe alle Lebensmittel – und das ist für die Menschen, die das Land von früher kennen, nur schwer zu verstehen – werden aus dem Ausland importiert.
Und nicht einmal die Ruhe der Toten haben sie geachtet! Die deutschen Friedhöfe sind zerstört, die Gräber geplündert und die Grabsteine einfach fortgetragen worden! Die Kirchen haben sie zu Kuhställen oder Lagerhallen umfunktioniert, und von einigen Dörfern sind nur noch die Fundamente geblieben. Alles haben sie kaputtgemacht, diese Russen! – "Aber bitte", meint da eine Frau ("ich bin Schütze und für Gerechtigkeit", hatte sie bei einer anderen Gelegenheit gesagt), "vergessen Sie doch nicht, dass wir den Krieg begonnen haben, und wir haben ihn verloren." Aber auch sie ist der Meinung, dass der Russe faul sei und nur gerade das tue, was er müsse: "Das ist eben seine Mentalität." "Vielleicht liegt das am Klima", meint ein anderer.
Umsiedlungen noch und noch
Der Wiederaufbau des eigenen Landes war für die Sowjetunion eine große Kraftanstrengung. 1700 Städte, 70.000 Dörfer, 32.000 Betriebe, 98.000 Kolchosen und 1900 Sowchosen hatte die Deutsche Wehrmacht auf ihrem Feldzug im Osten zwischen 1941 und 1944 zerstört; Fabriken waren gesprengt, Schachtanlagen geflutet und 65.000 Kilometer Eisenbahnlinien zerlegt worden. Die Politik der Verbrannten Erde hatte 25 Millionen Menschen obdachlos gemacht, die "Dezimierung des slawischen Untermenschen" zwischen zwanzig und dreißig Millionen Tote gefordert. Geld und Material zum Wiederaufbau ihres Landes mussten sich die Sowjets aus den besetzten Gebieten beschaffen, von den geforderten Reparationszahlungen sahen sie nur wenig. Auch deshalb lag Kaliningrad noch zwölf Jahre nach Kriegsende gänzlich in Trümmern.
2500 nordostpreußische Dörfer sind seit dem Krieg von der Landkarte verschwunden, die meisten davon in den sechziger Jahren. Wie überall in der Sowjetunion waren damals im Zuge einer Industrialisierungsoffensive weite Teile der Dorfbevölkerung in Städte und neue Kolchosensiedlungen transferiert worden. Zwar leben heute im Verwaltungsgebiet Kaliningrad etwa so viele RussInnen wie früher Deutsche (knapp über eine Million), doch die wenigsten sind noch Bauern. Beinahe zwei Drittel wohnen in Städten, darunter 200.000 Soldaten. Auf dem Land sind oft nur die Alten geblieben.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist es nur in wenigen Fällen gelungen, die großen Betriebe weiterzuführen. Selbst in der Bernsteingrube von Jantarnyi, dem ehemaligen Palmnicken, stehen die Schaufelräder still. Zu Sowjetzeiten wurden hier pro Jahr achtzig Tonnen Bernstein ausgebaggert. Jetzt laufen die Förderbänder nur noch einmal im Monat, für mehr reicht das Geld nicht.
Dass die Betriebe heute nach marktwirtschaftlichen Kriterien arbeiten müssen, ist für die Selbstversorgung des Landes verheerend: Milch etwa gibt es billiger aus Polen, das Fleisch kommt zu Schleuderpreisen aus den USA. Wer will da noch produzieren. Fremdenverkehr ist derzeit das einzige blühende Geschäft: Dass so viele Deutsche ihre alte Heimat wiedersehen wollen, hat den Aufbau von Hotels, Ein-Mann-Taxiunternehmen, Stadtreinigungsfirmen, Restaurants bewirkt. Doch das Ende ist absehbar, in zehn, fünfzehn Jahren werden nur wenige HeimwehtouristInnen noch willens oder in der Lage sein, hierher zu reisen.
Abrüsten aus Notwehr
Als Ausländerin werde man bezeichnet, ausgerechnet hier und ausgerechnet von jenen dort – "dabei bin ich doch hier geboren!" ereifert sich eine grauhaarige Dame, als wir nach einer Stadtrundfahrt in Baltijsk, dem ehemaligen Pillau, am Mittagstisch sitzen. Sie hatte sich erregt, als der junge Stadtführer uns erklärte, dass er aus Baltijsk sei und "wie wir Ausländer" ein Visum benötige, um nach Kaliningrad oder anderswohin zu fahren; denn Baltijsk sei noch immer militärisches Sperrgebiet. Die Frau weiß, dass hier bereits die dritte Generation RussInnen aufwächst, dass diese Menschen sich ihr eigenes Leben eingerichtet und somit eine neue Realität geschaffen haben. Doch das Herz kommt da nicht mit.
Über eine halbe Million Menschen waren gegen Ende des Krieges von hier aus nach Gdynia (das damals noch, weil Hitler es so wollte, Gotenhafen hieß) oder Dänemark evakuiert worden. Einige Schiffe erreichten ihr Ziel nicht; das Passagierschiff "Wilhelm Gustloff" etwa, benannt nach dem Leiter der "Landesgruppe Schweiz" der NSDAP, wurde von einem sowjetischen U-Boot versenkt, mit mehreren tausend Flüchtlingen an Bord.
Nach dem Krieg wurde Pillau in Baltijsk umbenannt und war fortan – als einer der wenigen eisfreien Häfen der Sowjetunion – ein wichtiger militärischer Brückenpfeiler, auch Atom-U-Boote waren hier stationiert. Noch immer reiht sich im Hafen Kriegsschiff an Kriegsschiff; dreißigtausend Menschen wohnen in der geschlossenen Stadt, die meisten sind Angehörige der Marine. Doch die Wehrhaftigkeit der grauen Flotte trügt. Da die Soldaten bereits seit einem halben Jahr keinen Sold mehr ausgezahlt bekommen haben, wird aus Notwehr abgerüstet: Stück für Stück weiden sie die Innereien der Schiffe aus und verkaufen die Ausbeute auf den Märkten: Buntmetallteile, Kabel, Rohre.
Am Frischen Haff
Behutsam manövriert unser Fahrer, den wir zu zweit für diesen Tag engagiert haben, seinen Lada um die Schlaglöcher der staubigen Allee. Wir fahren in Richtung Frisches Haff. Hier war er noch nie, und er ist froh, dass er für diesen Ausflug nicht seinen guten Mercedes genommen hat. Die Allee ist schön, lauter alte Linden. Hinter einem dieser Bäume hatte sich mein Vater, damals im Februar 1945, noch rechtzeitig vor einem russischen Fliegerangriff in Sicherheit bringen können; die Rückseite des Baumes wurde von den Geschoßen zerfetzt.
Dann öffnet sich die Allee, vor uns liegt das blaue Wasser des Frischen Haffs und ein weiter, schöner Strand. Am Horizont ist im Dunst die Frische Nehrung zu erkennen, die Landzunge, die beinahe bis Pillau reicht. Hierher also kamen die Menschen, um ihre Flucht auf dem einzig noch offenen Weg aus Ostpreußen anzutreten: über das Eis nach Pillau und weiter in den Westen. Schreckliches hat mein Vater hier erlebt. Zu Tausenden waren sie auf dem bereits brüchigen Eis unterwegs, zu Fuß, mit Pferdefuhrwerken. Aus der Luft beschossen von sowjetischen Flugzeugen, die das Eis mit Bomben zum Bersten brachten und Wagen, Menschen, Pferde versenkten. Nie wieder, hat mein Vater erzählt, habe er Menschen und Tiere so schreien gehört. Heute liegt das Haff friedlich und still da. Wie lange wohl hat es gedauert, bis sich das Leichengift zersetzt, das Wasser wieder geklärt hatte?
Unerreichbares Silberbestecke
Die drei Freundinnen kommen abends kichernd von ihrer Erkundungsfahrt zurück, ihr Fahrer hatte ihnen tüchtig Wodka eingeschenkt. Ja, sagt mir die eine, als ich von der herrlichen Landschaft und dem weiten Himmel schwärme, "so hoch ist der Himmel nur über Ostpreußen." Ihrer Freundin ist es auch diesmal nicht besser ergangen. Wieder hat sie in Tränen aufgelöst versucht, an die Überreste ihres Elternhauses zu gelangen, die unerreichbar, aber zum Greifen nah im Sperrgebiet der polnisch-russischen Grenze liegen. Könnte sie dorthin, vielleicht fände sie unter der Erde noch das Brautkleid ihrer toten Schwester, das man vor dem Zugriff der Russen bewahren wollte, sie fände die Suppenterrine, die guten Teller, das Silberbesteck. Auch Lebensmittel hatten die Menschen damals in aller Eile vergraben, Speck, Fleisch und Wurst, "möglichst in lockerem Boden, damit nichts zerdrückt wird", erzählen die drei Frauen. "Wir dachten ja, wir kämen bald wieder zurück."
© Brigitte Matern, erschienen in WOZ Nr. 44/97 vom 31.10.1997